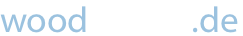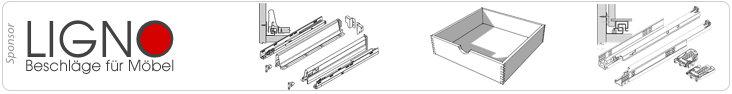Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Restfeuchtebestimmung von Schnittholz
- Ersteller Mitglied 132096
- Erstellt am
-
- Schlagworte
- holzfeuchtemessung restfeuchte
Mitglied 132096
Gäste
Danke dir, das hilft weiter. Wenn ich deine Messgeräte mit meinem vergleiche ist das eine ganz andere Liga. Alleine schon, dass man die Elektroden mit einem Gewicht ins Holz eintreiben kann.Bei meinem Gabb kann man die Temperatur einstellen.
Das ist wichtig wenn man im Trockner messen möchte.
Das Merlin ist ganz interessant: Mit unterschiedlichen Schaltstellungen wird hier zwischen verschiedenen Holzsorten unterschieden.
Das würde auch zu der Ausgangsfrage passen, warum sich mit meinem primitiven Messgerät unter sonst gleichen Bedingungen Abweichungen bei Restfeuchten bei verschiedenen Holzarten ergeben.
Scheinbar gibt es hier tatsächlich Unterschiede bei unterschiedlichen Holzarten, die das Merlin ausgleicht bzw. ausgleichen kann.
Mitglied 132096
Gäste
... ich hab mir mal das Merlin genauer angesehen. Das funktioniert scheinbar mit Infrarot und verzichtet auf Elektroden.
Das WS 8 wurde durch das neuere WS 9 ersetzt, von dem es wiederum unterschiedliche Typen gibt, abhängig welche Holzdicke man messen will.
Das WS 8 wurde durch das neuere WS 9 ersetzt, von dem es wiederum unterschiedliche Typen gibt, abhängig welche Holzdicke man messen will.
MTrp
ww-robinie
Merlin schreibt in der Bedienungsanleitung (sinngemäß), dass das Gerät eine ähnliche Temperatur wie das zu prüfende Werkstück haben soll. Also nicht mit dem Messgerät aus der warmen Wohnung in die kalte Werkstatt gehen und gleich messen, sondern zuerst mal 15min “akklimatisieren“ lassen.
Mitglied 132096
Gäste
Hier ist eine genaue Beschreibung von dem Merlin HM9:
https://www.mess-werkzeug-kiste.de/...-----385-635-674-675-676-677.html?language=de
https://www.mess-werkzeug-kiste.de/...-----385-635-674-675-676-677.html?language=de
Hier gibt es kompetente Auskunft, wenn würde ich direkt kaufen. Das Duo wäre mein Favorit. Hat jemand aktuelle Preise, fragen möchte ich nicht weil ich jetzt kein Gerät brauche.
Hier noch ein Teil das in jede Holzbude oder Baustelle gehört.
Hier noch ein Teil das in jede Holzbude oder Baustelle gehört.
Zuletzt bearbeitet:
Mitglied 132096
Gäste
370 Euro für ein Profi- Holzmessgerät ist m. M. nach ein akzeptabler Preis, wenn das Gerät auch tatsächlich zuverlässig misst. Davon gehe ich aber aus.Von denen habe ich das Gerät damals gekauft, ist aber deutlich günstiger geworden (wenn ich mich recht erinnere).
Aber wenn man überlegt dass man für das Geld auch einen Fernseher bekommt ist das noch teuer genug
Momentan brauche ich das Gerät nicht, deswegen werde ich noch etwas abwarten. Interessant wird ein Gerät erst wenn ich die Hölzer verarbeiten möchte und dazu braucht es noch etwas Zeit.
Mein Holzhändler hat mir letzte Woche gesagt (im gesoräch zur Lohntrocknung), dass die allgemein immer wieder erwähnten Max zu erzielenden 15% restfeuchte bei Lufttrocknung unrealistisch sind. Er vertritt maximal 17% eher etwas mehr.In einem anderen Post kam die Frage auf, welche Restfeuchte das Schnittholz haben sollte um daraus Möbel zu bauen, die sich am späteren Aufstellungsort so wie gewünscht verhalten.
Wen es interessiert, hier ist der gesamte Post (ab #79 gehts los) dazu:
https://www.woodworker.de/forum/threads/eichentisch-bauen.135356/
Um gleich vorweg zu schicken, es ist bekannt, dass zum Bau von Möbeln, die später in einem Wohnraum aufgestellt werden sollen eine Restfeuchte vom Schnittholz irgenwo zwischen 8 und 9% optimal ist. Diese Werte lassen sich - soweit mir bekannt ist - nur durch Trocknung in einer Trockenkammer erreichen.
Bei normalen Umgebungsbedingungen an der Luft sind je nach Jahreszeit und Temperautur Werte zwischen 12 und 15 % normal. Das ist, was mir bekannt ist. Bitte korrigiert mich, falls ich hier etwas falsche schreibe.
Die Werte sich Erfahrungswerte, die mit einem sehr billigen Holzfeuchtemessgerät bei Eschenholz von mir ermittelt wurden und unterliegen eine großen Streuung, je nachdem wo ich messe und ob ich längs oder quer zur Faser messe oder auch an der Stirnseite.
Es wird mit Sicherheit so sein, dass mit einem teureren Messgerät andere Messwerte mit geringerer Streuung zu erwarten sind. Mir geht es auch nicht nachfolgend um absolute Werte, sondern wie die Werte in Relation zu einander zu bewerten sind. Deshalb bitte keine Grundsatzdiskussion über die Qualität von Holzfeuchtemessgeräten, das weiß ich selbst, dass es bessere Messgeräte gibt. Aber nun zum eigentlichen Thema:
Ich habe vor 2 Jahren unterschiedliche Hölzer einsägen lassen. Die Hölzer wurde alle in etwas zur selben Zeit gefällt und zum gleichen Zeitpunkt aufgetrennt und weisen alle in etwas dieselbe Dicke auf (35mm oder 55mm).
Alle Bretter und Bohlen lagern am selben Ort gleich lange. Es handelt sich hierbei um: Ahorn, Eiche, Esche, Robinie, Ulme (Rüster), Birke, Fichte, Kiefer
Wenn ich immer zum gleichen Zeitpunkt immer dieselbe Messmethode anwende (längs zur Faser, auf der Brettoberfläche), erhalte ich sehr unterschiedliche Messergebnisse, bei gleich dicken Brettern (35mm) aber unterschiedlichen Holzarten. Wenn ich quer zur Faser messe, sind zwar bezogen auf jeweils eine Holzsorte, die Messwerte um 1 oder 2 % niedriger, aber in Relation gesehen zu anderen Holzarten ist die Restfeuchte unterschiedlich hoch.
Dieses Phänomen ist mir nicht erklärbar.
Beispiel:
Ahorn, Restfeuchte auf der Brettoberseite längs zur Faser: 14%, quer zur Faser 12%
Ulme, Restfeuchte auf der Brettoberseite längs zur Faser: 18%, quer zur Faser 16%
Fichte, Restfeuchte auf Brettoberseite längs zur Faser: 11%, quer zur Faser 10%
Kiefer, Restfeuche auf Brettoberseite längs zur Faser 12 % quer zur Faser 10%
Esche, Restfeuche längs 13%, quer 12%
Wie kann das sein?
Ich würde erwarten, dass die Messwerte von der Restfeuchte bei unterschiedlichen Holzarten entweder längs oder quer zur Faser immer gleich sind, weil sich mit der Umgebungsluft ja ein Gleichgewicht einstellt zwischen Holzfeuchte und Luftfeuchte der Umgebungsluft. Das ist aber praktisch nicht der Fall.
Hat jemand dafür eine plausible Erklärung?
Ich würde mir wünschen, dass sich die Diskussion nicht um die Qualität der Holzfeuchtemessgeräte dreht, sondern das Phänomen, warum bei unterschiedlichen Hölzern unterschiedliche Restfeuchten auftreten obwohl sie alle "gleich" trocken sein sollten.
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Claus
Richtig, ich wundere mich auch wenn von 15% die Rede ist, bei uns sind es 17%, die Säger gehen von 20% aus.Mein Holzhändler hat mir letzte Woche gesagt (im gesoräch zur Lohntrocknung), dass die allgemein immer wieder erwähnten Max zu erzielenden 15% restfeuchte bei Lufttrocknung unrealistisch sind. Er vertritt maximal 17% eher etwas mehr.
Mitglied 132096
Gäste
Das Sägewerk meines Vertrauens trocknet die Balken auch nicht weiter herunter als bis 17 bis 18%. Allerdings sind das Balken, Schalbretter bzw. allgemein Bauholz für Dachstühle, Carports etc. und kein Schreinerholz.Mein Holzhändler hat mir letzte Woche gesagt (im gesoräch zur Lohntrocknung), dass die allgemein immer wieder erwähnten Max zu erzielenden 15% restfeuchte bei Lufttrocknung unrealistisch sind. Er vertritt maximal 17% eher etwas mehr.
Für Schreinerholz ist das noch zu feucht. Bei dem Sägewerk hab ich übrigens angefragt, ob sie meine Esche trocknen würden. Er hat mit dem oben beschriebenen Argument abgelehnt: Mit Laubholz kennen wir uns nicht aus und haben keine Erfahrung. Außerdem trocknen wir sowieso nur bis höchstens 16% und nicht weniger.
.... und wenn wir für dich was trocken sollen, dann muß die gesamte Trockenkammer aus einer Holzsorte sein, weil wir unterschiedliche Trocknungskurven fahren.
Damit war für mich das Thema: Möbelholz trocknen erledigt.
Wenn man das zu früher vergleicht ist das für Bauholz schon ein riesen großer Schritt. Ich kann mich noch gut an die 70er und 80er Jahre erinnern. Da wurde von den Zimmerern bzw. Sägewerken überhaupt kein Bauholz getrocknet. Das wurde Aufgesägt und der Dachstuhl wurde mit nassem Holz aufgestellt. Das hat keinen interessiert und die Dachstühle sind auch nicht zusammengebrochen oder gefault. Da kam noch ordentlich Borsalz als Beschichtung gegen Schädlinge drauf und das Holz ist dann auf dem Dach getrocknet.
Heute mit den ganzen Sichtdachstühlen ist das nicht möglich. Ob trockenes Bauholz für Niedrigenergiehäuser oder den neuen Belüftungskonzepten für Dachstühle vorausgesetzt wird, kann ich nicht beantworten. Da fehlt mir das Hintergrundwissen.
@Fichtenelch als gelernter Zimmerer kann da bestimmt mehr dazu sagen.
Wenn ich so nachdenke kommt mir noch ein ganz anderer Gedanke:
Wie wurde den früher (Barockzeit, Biedermeier) Möbelholz getrocknet? Damals gabs ja noch keine Trockenkammern und die Möbel gibt es bis heute und sind wunderschön. Ist das Wissen, wie man Möbel aus luftgetrockneten Holz bauen kann noch vorhanden, oder gibt es noch andere Trocknungstechniken um zum gleichen Ergebnis zu kommen?
Das wäre auch mal eine Überlegung wert.
Ich schaffe, wenn das Holz lange genug liegt, sogar 14%.Richtig, ich wundere mich auch wenn von 15% die Rede ist, bei uns sind es 17%, die Säger gehen von 20% aus.
Allerdings haben wir hier ein wesentlich besseres Klima als in Deutschland.
Viel mehr trockene und andauernde Hochdrucklagen.
Danke dir, das hilft weiter. Wenn ich deine Messgeräte mit meinem vergleiche ist das eine ganz andere Liga. Alleine schon, dass man die Elektroden mit einem Gewicht ins Holz eintreiben kann.
Das Merlin ist ganz interessant: Mit unterschiedlichen Schaltstellungen wird hier zwischen verschiedenen Holzsorten unterschieden.
Das würde auch zu der Ausgangsfrage passen, warum sich mit meinem primitiven Messgerät unter sonst gleichen Bedingungen Abweichungen bei Restfeuchten bei verschiedenen Holzarten ergeben.
Scheinbar gibt es hier tatsächlich Unterschiede bei unterschiedlichen Holzarten, die das Merlin ausgleicht bzw. ausgleichen kann.
Das geht bei deinem Testo doch auch oder?
Mein Testo kann das
Mitglied 132096
Gäste
+1 Die Esche, die bei mir schon seit 7 Jahren in der Scheune liegt hat eine Restfeuchte von 13% (gemessen mit dem Billigholzfeuchtemessgerät quer zur Faser). Im Herbst, wenn es neblig wird etwas mehr, aber nicht viel. Vielleicht 1 oder 2%, das schwankt immer ein bischen auch schon je nachdem wo ich im Brett messe.Ich schaffe, wenn das Holz lange genug liegt, sogar 14%.
Allerdings haben wir hier ein wesentlich besseres Klima als in Deutschland.
Viel mehr trockene und andauernde Hochdrucklagen.
Mich interessiert das Thema schon seit längeren, deswegen messe ich unregelmäßigen Abständen immer wieder mal nach.
Mitglied 132096
Gäste
Ich glaube da bringst du etwas durcheinander. Ich glaube Andi (@andibarth) hat ein Testo. Mein Messgerät ist ein ganz billiges zum Feuchtigkeit messen von Brennholz. Das hier:Das geht bei deinem Testo doch auch oder?
Mein Testo kann das
https://de.trotec.com/shop/feuchtem...MI6LD7p66-iwMV0Z2DBx3BsCvSEAQYBCABEgIWd_D_BwE
Man kann auch Möbel mit 25% bauen.
Es gibt irgendwo eine Tabelle welche Holzsorte wieviel Volumenänderung in welcher Richtung pro Prozentpunkt Holzfeuchte macht.
Wissenschaftlich geprüft habe ich das nicht. Aber viel getrocknet, das kommt schon hin.
Ist interessant.
Faszinierend ist dann, wenn Messgerät, Trockenkammer und Erfahrungswerte übereinstimmen. Dazu passt dann tatsächlich das Hygrometer im Lager und der Werkstatt auch noch.
Es gibt irgendwo eine Tabelle welche Holzsorte wieviel Volumenänderung in welcher Richtung pro Prozentpunkt Holzfeuchte macht.
Wissenschaftlich geprüft habe ich das nicht. Aber viel getrocknet, das kommt schon hin.
Ist interessant.
Faszinierend ist dann, wenn Messgerät, Trockenkammer und Erfahrungswerte übereinstimmen. Dazu passt dann tatsächlich das Hygrometer im Lager und der Werkstatt auch noch.
Das ist natürlich ein Spielzeug das Du da hast.
Du kannst damit ja nur die Feuchte des obersten cm messen.
Auch wenn Du damit Brennholz misst musst Du das Holz erst spalten und dann in der Mitte messen.
Das ist zwar alles mit dem Testo das gleiche, nur dürfte diese halt genauer sein.
Mit einem Schreinertauglichen Gerät kannst du beide nicht vergleichen.
Du kannst damit ja nur die Feuchte des obersten cm messen.
Auch wenn Du damit Brennholz misst musst Du das Holz erst spalten und dann in der Mitte messen.
Das ist zwar alles mit dem Testo das gleiche, nur dürfte diese halt genauer sein.
Mit einem Schreinertauglichen Gerät kannst du beide nicht vergleichen.
Mitglied 132096
Gäste
Deswegen hab ich nach was besseren für Schreinerholz gefragt. Dass das Messgerät (falls man das überhaupt als solches bezeichnen kann) für Schreinerholz unbrauchbar ist, ist mir klar. Das hab ich schon ganz am Anfang bei der Ausgangsfrage klargestellt.Das ist natürlich ein Spielzeug das Du da hast.
Off Topic:
Ganz ehrlich: meinem Schwedenofen ist das vollkommen egal, ob das Holz jetzt 15% Restfeuchte hat oder 18%. Entscheidend ist eher: Sind es 16% Restfeuchte oder 30%. Für Brennholz reicht ein grobes Schätzeisen vollkommen aus. Für Brennholz nehme ich meist ein Holzscheit in die Hand und alleine vom Gewicht hat man ein Gefühl, ob das Holz schon eingeheizt werden kann oder nicht, insbesondere bei Nadelholz.
Dir als Ofenbauer brauch ich da nix zu erzählen, das weißt du besser als ich.
Bei uns lagert das Brennholz sowieso mindestens 1 bis 2 Jahre aufgespalten an einem zugigen Ort im Freien. Meist säge ich 15 bis 18 Ster an zwei Tagen irgendwann zwischen Mitte Juli bis Mitte September. In dem Zeitraum sind normalerweise längere Trockenperioden und ich bekomme mein Brennholz immer trocken auf meine Wägen. Dort verbleibt es dann unter Dach, bis es direkt verheizt wird.
Das reicht dann für die ganze Heizsaison für zwei Häuser.
Und regnet es mal das ganze Jahr immer wieder, dass das Holz zu feucht ist, dann nehme ich mein Brennholz aus der Scheune. Da liegt für mindestens 5 bis 8 Jahre Brennholz. Das ist überwiegend lauter Buche und ein bischen Nadelholz. Das Holz ist aber so knochentrocken, dass es eine sehr große Hitze erzeugt und das ist auch nicht gut für den Ofen oder Kamin. Deswegen versuche ich immer ein bischen Laub- und Nadelholz zu mischen. Außerdem versuche ich das Holz nicht länger als 3 Jahre zu lagern, aber momentan ist das schwierig weil immer wieder frisches Brennholz nachkommt und verkauft wird nichts, da steckt zu viel Arbeit von mir drin.
Soviel als kleinen Ausflug, zum Thema trockenes Brennholz und wie ich mein Schätzeisen verwende.
seschmi
ww-robinie
Zur Ausgangsfrage: Es ist auch einsichtig, dass die Leitfähigkeit bei verschiedenen Hölzern verschieden ist, auch wenn der Wassergehalt gleich ist.
Leitfähigkeit hängt ja nicht nur vom Wasser ab, sondern mehr noch von den enthaltenen gelösten Ionen. Miss mal den Widerstand von destilliertem Wasser, und dann gib etwas Salz dazu.
Und warum sollte der Salzgehalt in unterschiedlichen Holzsorten nicht unterschiedlich sein? Und das ist sicher nicht das einzige, was die Leitfähigkeit beeinflusst.
Leitfähigkeit hängt ja nicht nur vom Wasser ab, sondern mehr noch von den enthaltenen gelösten Ionen. Miss mal den Widerstand von destilliertem Wasser, und dann gib etwas Salz dazu.
Und warum sollte der Salzgehalt in unterschiedlichen Holzsorten nicht unterschiedlich sein? Und das ist sicher nicht das einzige, was die Leitfähigkeit beeinflusst.
Mitglied 132096
Gäste
Ja, durchaus, das steht m. M. nach auch nicht im Widerspruch ganz im Gegenteil. Das erklärt warum man einfache Meßgeräte nicht verwenden kann, um die Restfeuchte mit einer gewissen Genauigkeit und Holzart zu bestimmen.Zur Ausgangsfrage: Es ist auch einsichtig, dass die Leitfähigkeit bei verschiedenen Hölzern verschieden ist, auch wenn der Wassergehalt gleich ist.
Leitfähigkeit hängt ja nicht nur vom Wasser ab, sondern mehr noch von den enthaltenen gelösten Ionen. Miss mal den Widerstand von destilliertem Wasser, und dann gib etwas Salz dazu.
Und warum sollte der Salzgehalt in unterschiedlichen Holzsorten nicht unterschiedlich sein? Und das ist sicher nicht das einzige, was die Leitfähigkeit beeinflusst.
Deswegen war die ganze Diskussion auch mit den unterschiedlichen Anzeigekarten von den alten Feuchtigkeitsmessgeräten oder das umschalten bei neueren Feuchtigkeistmessgeräten unheimlich lehrreich um belastbare Angaben zur Restfeuchte zu bekommen.
Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass hier mal das im Forum vorhandene Wissen genutzt wird um wertneutral zu diskutieren und durchaus kritisch das ganze Thema "Restfeuchte" zu hinterfragen um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Als Zwischenbilanz hab ich das Gefühl, dass in (fast) jedem Post irgend ein Erkenntnisgewinn dazugekommen ist.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo,
erstmal hier mein Feuchtemessgerät von Bollmann.

Auch hier werden, je nach Holzsorte unterschiedliche Stufen eingestellt.
Ein Gesichtspunkt, der noch nicht aufgezeigt wurde, wenn ich nichts überlesen habe.
Beispiel:
Ein Kubikdezimeter von dichtem Holz wiegt trocken 700g. Nimmt dieser Klotz 70g Wasser auf beträgt die Holzfeuchte 10%.
Ein gleicher Würfel von leichtem Holz wiegt 350g. Nimmt dieser Klotz nun auch 70g Wasser auf, beträgt die Holzfeuchte 20%.
Unabhängig von der ganzen Messerei sind bei Massivholzverarbeitung die bewährten Verarbeitungsregeln zu berücksichtigen. So fährt man immer gut.
Bei mir hat sich bewährt, das grob zugeschnittene Holz im Wohnzimmer eine Zeit lang zu lagern. Christiane macht das mit.
Gruß Ingo
erstmal hier mein Feuchtemessgerät von Bollmann.

Auch hier werden, je nach Holzsorte unterschiedliche Stufen eingestellt.
Ein Gesichtspunkt, der noch nicht aufgezeigt wurde, wenn ich nichts überlesen habe.
Beispiel:
Ein Kubikdezimeter von dichtem Holz wiegt trocken 700g. Nimmt dieser Klotz 70g Wasser auf beträgt die Holzfeuchte 10%.
Ein gleicher Würfel von leichtem Holz wiegt 350g. Nimmt dieser Klotz nun auch 70g Wasser auf, beträgt die Holzfeuchte 20%.
Unabhängig von der ganzen Messerei sind bei Massivholzverarbeitung die bewährten Verarbeitungsregeln zu berücksichtigen. So fährt man immer gut.
Bei mir hat sich bewährt, das grob zugeschnittene Holz im Wohnzimmer eine Zeit lang zu lagern. Christiane macht das mit.
Gruß Ingo
Fichtenelch
ww-robinie
Na ich sage mal so, die meisten Bauten werden mit Fichte KVH geplant, dort geht man von 15% Restfeuchtigkeit aus.Ob trockenes Bauholz für Niedrigenergiehäuser oder den neuen Belüftungskonzepten für Dachstühle vorausgesetzt wird, kann ich nicht beantworten
Das ist in etwa die Richtung.
Damals mit feuchten und säugerauen Holz wurde komplett anders gebaut.
Im Bereich Fußboden gab es Einschub, dieser nahm Feuchtigkeit ohne Probleme auf und gab ihn mit der Zeit ab.
Der Holzfußboden war Diffusionsoffen und die Einschubebene hinterlüftet.
Zwischensparrendämmung gab's damals nicht.
Die Latten kamen ohne Folie auf die Sparren.
Sparrenfelder blieben frei, also genügend Luft damit die Sparren trocknen konnten.
Räume unter dem Dach waren mit separaten Wänden abgetrennt, zum Bereich der Dachschräge war genügend Platz für eine Hinterlüftung.
Habe zig solcher Bauten gesehen, bei vielen war die Substanz wirklich noch sehr gut.
Die wussten damals schon was die machen.
Heute ist Zwischensparrenndämmung möglich da das Holz technisch getrocknet und gehobelt ist.
So zumindest habe ich es mal gelernt.
Die Meinungen gehen da aber auseinander.
SteffenH
ww-robinie
- Registriert
- 29. August 2011
- Beiträge
- 2.946
Es gab auch keine dauerhaft beheizten Räume mit 20° bei 50% rel. Luftfeuchte.Wie wurde den früher (Barockzeit, Biedermeier) Möbelholz getrocknet? Damals gabs ja noch keine Trockenkammern